
Patient*innenorientierte Digitalisierung : Eine ethische Analyse der Rolle von Patient*innen- und Selbsthilfeorganisationen als Akteure im Zusammenhang mit Digitalisierung in der gesundheitlichen Forschung und Versorgung (PANDORA)
Institut für Ethik und Geschichte der Medizin
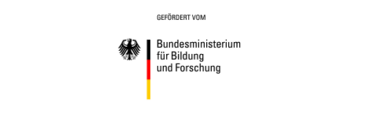
Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Projektleitung: HAW Hamburg (Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg)
Laufzeit: Dezember 2021 – April 2025
Im Teilprojekt 1 bearbeitet von:
- Prof.*in Dr. Silke Schicktanz
- Dr. Jan Hinrichsen
- Karina Korecky, M.A.
Hintergrund
Das Projekt „PANDORA- Patient*innenorientierte Digitalisierung“ ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes Verbundprojekt unter Leitung der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) in Kooperation mit der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Gemeinsam wird hier die Expertise aus angewandter und empirischer Ethik, Medizinanthropologie, Public-Health- und Public-Patient-Involvement-Forschung gebündelt.
Patient*innenorganisationen (PO) und Selbsthilfeorganisationen (SHO) setzen bei ihrer Arbeit immer häufiger gezielt auf digitale Instrumente. Der Forschungsverbund PANDORA hat daher die ethischen und sozialen Aspekte bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen und der Forschung hierzu analysiert. Zentral waren dabei Digitalisierungsprojekte und Forschung, worin PO und SHO als Stakeholder und Co-Forschende beteiligt waren. Für die entsprechende Analyse arbeitete das Forschungsteam mit Vertreter*innen von verschiedenen PO und SHO zusammen.
Mit der Entwicklung unterschiedlicher Formate soll dabei die Partizipation von PO und SHO sowie die digitale Gesundheitskompetenz der Betroffenen und der breiten Öffentlichkeit verbessert werden.
Ergebnisse

Das Positionspapier
Zum Abschluss des Projekts wurde ein Positionspapier über die Mitarbeit von Patient*innenorganisationen in der digitalen Gesundheitsforschung veröffentlicht, welches im Rahmen der ersten deutschlandweiten Stakeholder-Konferenz erarbeitet wurde.
Es handelt sich um ein Strategiepapier für die gelingende Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftler*innen und Patient*innen als Co-Forscher*innen.
Der Entstehungsprozess vollzog sich in drei Schritten:
- Der erste Schritt war eine Konferenz (3.-4. Juni 2024) in Hamburg zur Gesundheitsforschung mit dem Titel „Digitale Gesundheitsforschung gemeinsam gestalten“. Dort trafen sich Vertreter*innen von fast 30 Patient*innen- und Selbsthilfegruppen. Sie erarbeiteten gemeinsam mit Hilfe des PANDORA-Forschungsteams einen ersten Entwurf des Positionspapiers.
- Im zweiten Schritt erarbeitete ein Team in Absprache mit den Teilnehmer*innen der Konferenz die Endfassung des Positionspapiers.
- Im dritten Schritt wurde das fertige Positionspapier am 12. November 2024 in Berlin der Öffentlichkeit und der Politik präsentiert.
In dem Positionspapier werden vier Forderungen an die Gesundheitspolitik erhoben:
- Die erste Forderung ist, bei Forschungsprojekten mitreden zu können. So soll die Lücke zwischen Forschung und Patient*innenorganisation kleiner werden. Dafür brauchen die Patient*innenorganisationen finanzielle Ressourcen, Strukturen, klare Arbeitsaufgaben und Technik.
- Zweitens braucht es eine Stärkung der Fähigkeiten, die nötig sind um mitzureden und mitzuentscheiden zu können. Dafür ist es wichtig, dass die Patientenvertreter*innen und die Forschung ihre jeweiligen Probleme und Wünsche klären.
- In der dritten Forderung geht es darum, Verständnis und Vertrauen auszubauen. Es wurde gefordert anzuerkennen, dass die Gesundheitsdaten den Patient*innen gehören. Die Bedingungen einer Sammlung von Daten zu Forschungszwecken sollen einfach und verständlich erklärt werden – wie z. B. der Zweck der Speicherung, die Datensicherheit und wer verantwortlich ist.
- Viertens ist es wichtig, dass Patient*innenorganisationen in die Forschung miteinbezogen werden – mit klaren Absprachen für die Zusammenarbeit. Dabei können sie mit ihren Fähigkeiten und Erfahrungen zur Forschung beitragen. Patient*innenorganisationen sollen dabei auch Forschungsmethoden lernen können, um aktiver mitforschen zu können.
Der Podcast
Um den Transfer der gewonnenen Einsichten und Kenntnisse in die Praxis zu gewährleisten, entstand im Rahmen des PANDORA-Projekts eine Podcast-Serie zum Thema „Digitale Wege im Gesundheitswesen: Blickpunkt Ethik, Patient*innen- und Selbsthilfeorganisationen“, an dem die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) maßgeblich mitgewirkt hat.
Der Podcast ist einerseits auf der Website, andererseits überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt: Spotify, Amazon, Deezer, Apple
Teilprojekte
Teilprojekt 1 (TP1)
Die erste Studie des Teilprojekts 1 (TP1) startete bereits im September 2022 und beschäftigte sich mit dem Thema „Ethik und Digitalisierung im Gesundheitswesen“. In einer Interviewstudie mit Vertreter*innen und Mitgliedern von verschiedenen Patient*innenorganisationen wurden dabei die Einstellungen, Erfahrungen und Einschätzungen von Patient*innen zu Themen wie elektronische Patient*innenregister, die Nutzung von Apps für das Gesundheitsmanagement oder die Einwilligung in die Nutzung von Daten für die medizinische Forschung erfasst.
Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und die Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) haben dabei zusammen das Ziel verfolgt, relevante Wertekonflikte, die Patient*innenorganisationen sowie Patient*innen im Kontext von Digitalisierungsprojekten erfahren, zu verstehen.
Darauf aufbauend sollten praktisch-ethische, soziale und kommunikative Strategien entwickelt werden, die die Vermeidung von Wertekonflikten fördern und die Vertretung der Interessen von Patient*innen bei Digitalisierungsprojekten unterstützen sollen. Hierzu wurden Interviews sowie eine systematisch-ethische Analyse durchgeführt.
Die Ergebnisse dienten der Entwicklung einer Online-Umfrage (TP2) und wurden in unterschiedlichen Formaten veröffentlicht, z. B. als wissenschaftliche Publikationen oder als Podcast (TP4) für Patient*innen.
Teilprojekt 2 (TP2)
Das Projektteam der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) war im Rahmen des Mixed-Methods-Ansatzes für die Durchführung von qualitativen Interviews und einer quantitativen Online-Befragung verantwortlich. Ziel dieser Studien war es, die Perspektive der Patient*innen- und Selbsthilfeorganisationen sowie ihrer Mitglieder bzgl. der Digitalisierungsprozesse im Gesundheitswesen und der aktiven Beteiligung an derartigen Initiativen zu ermitteln. So sollten u. a. Erfahrungen, Einstellungen und Möglichkeiten hinsichtlich derartiger Beteiligungsaktivitäten identifiziert werden. Die Ergebnisse der Befragung flossen in die Entwicklung von ethischen Bewertungskriterien und Empfehlungen für Digitalisierungsprozesse ein. Außerdem wurde die Resultate publiziert.
Teilprojekt 3 (TP3)
Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) hat im Rahmen des TP3 untersucht, wie Patient*innenorganisationen ethische Probleme der Digitalisierung wahrnehmen und wie sie diese eigenständig zu lösen versuchen. Sie war insbesondere verantwortlich für die Durchführung von Fokusgruppen mit Vertreter*innen von Patient*innenorganisationen, die dabei helfen sollten, die Sicht der Patient*innenorganisationen auf Fragen der Digitalisierung besser zu verstehen. Untersucht wurde, was aus Sicht von Patient*innenorganisationen eine angemessene Governance von Digitalisierungsprojekten ausmacht.
Die UMG hat zudem ein Kriterienkatalog zur ethischen Evaluation solcher Fragen erarbeitet, der von den Teams des TP1 und TP2 ergänzt wird.
Teilprojekt 4 (TP4)
Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) ist als Koordinationsstelle des Projekts zuständig für den Transfer der gewonnenen Einsichten und Kenntnisse in die Praxis. Beispiele für diese Transferformate sind z.B. die Website oder auch der Podcast, an dem die UMG maßgeblich mitgearbeitet hat.