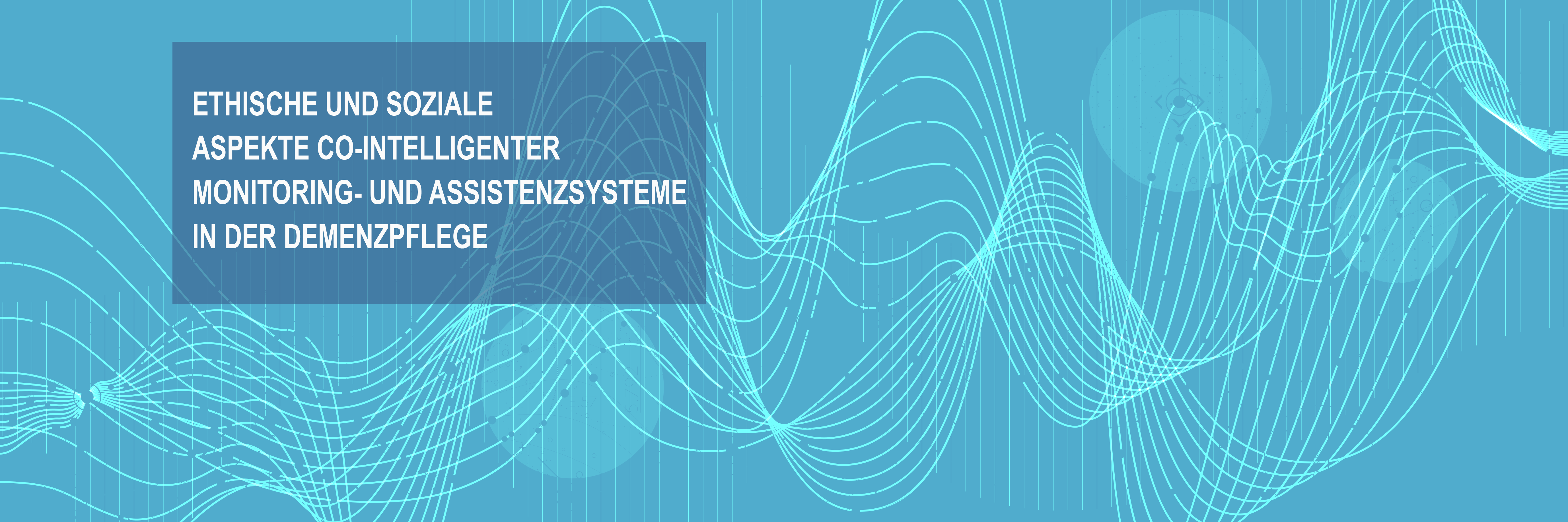
Ethische und soziale Aspekte co-intelligenter Monitoring- und Assistenzsysteme in der Demenzpflege (EIDEC)
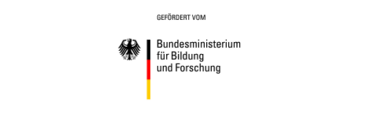
Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Laufzeit: Jan 2020 - Jun 2023
Projektpartner: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg; Universität Rostock; Universitätsmedizin Rostock; Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)
Hintergrund
Aufgrund des demographischen Wandels und technischer Innovationen erfährt die Versorgung von Menschen mit Demenz eine grundlegende Veränderung. Neue co-intelligente Monitoring- und Assistenzsysteme (CIMADeC) erlauben es, das Verhalten von Menschen mit Demenz zu beobachten und zu unterstützen. Ziel des Einsatzes solcher Technologien ist es, ein unabhängiges Leben der Betroffenen zu fördern und zu ermöglichen, Probleme frühzeitig zu erkennen, Pflegende zu entlasten und insgesamt die Qualität und Kosteneffizienz der Versorgung zu steigern. Diese sozio-technischen Systeme bezeichnen wir als „co-intelligent“, da sie künstliche Intelligenz (KI) und menschliche Interpretation in Mensch-Maschine-Interaktionen integrieren.
Zielsetzung
Im Verbundprojekt untersuchen wir in verschiedenen Teilprojekten solche co-intelligenten Systeme in der Demenzversorgung in zwei alltagsnahen Anwendungsbereichen, der institutionellen und der häuslichen Pflege. In der Kombination von Technikbewertung und empirisch informierter Ethik beforschen wir die soziale Akzeptanz und moralische Bewertung der Anwendungen mittels qualitativer Interviews in verschiedenen Gruppen:
- Patient*innen
- Familienangehörige
- professionell Pflegende
- Ärzt*innen
Die ethische Analyse fokussiert dabei auf zwei wichtige ethische Konzepte in der Demenzversorgung:
- Privatheit
- Empowerment
Teilprojekte EIDEC
TP1: Wertsensitives und affektbewusstes Design
Teilprojekt 1 (TP 1) wird an der Universität Rostock und dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in der Helmholtz-Gemeinschaft von Prof. Dr.-Ing. Thomas Kirste und Prof. Dr. Stefan Teipel geleitet.
Ziel
Ziel dieses Teilprojektes ist es, das Potenzial des Einsatzes intelligenter Sensortechnologien für patientenzentrierte Versorgung, die Effizienz von Pflegeprozessen und Empowerment von PatientInnen und Pflegenden weiter auszuschöpfen. Bislang stellen sich hier vor allem bezüglich des Zugriffs auf umfangreiche kommentierte Daten, die die Grundlage für das Training und die Kalibrierung der Systeme bilden, weitreichende ethische und rechtliche Herausforderungen. Betroffene müssen daher frühzeitig in den Forschungsprozess eingebunden werden, um akzeptable und nachhaltige Leistungen für die Datengewinnung zu erarbeiten. Darüber hinaus benötigen intelligente Erfassungssysteme ein ethisch reflektiertes Vokabular, um das Alltagsverhalten zu kennzeichnen. Aus diesem Vokabular werden das „Ground-truth“-Codebuch erstellt und die Dimensionen der Interpretation des mechanischen Verhaltens definiert. Es stellt somit eine Einschätzung der Rationalität und der Auswirkungen des individuellen Verhaltens in Bezug auf den Gesundheitsprozess und seine inhärenten Werte dar. Diese Verbindung zwischen Gesundheitswerten und Ontologie-Design soll schon im wertsensitiven und affektbewussten Design der Systeme berücksichtigt werden. TP 1 wird organisatorische und technische Methoden entwickeln, um einen angemessenen Kompromiss zwischen ethischen Belangen, Empowerment und Forschungsbedarfen zu erreichen. Im Hinblick auf den Lebenszyklus intelligenter Sensorsysteme konzentriert sich das TP 1 dabei auf die kritische Phase von Studien zur Systementwicklung.
Methodik
Ein systematischer Ansatz zur Erreichung der Ziele muss in drei Richtungen voranschreiten:
(1) Gewährleistung der Akzeptanz von Studien zur Systementwicklung durch die Stakeholder,
(2) Untersuchung von Ersatztechnologien zur Gewinnung von Trainingsdaten,
(3) angemessene Berücksichtigung der affektiven Wertigkeit von Vokabularen zur Verhaltensinterpretation.
Das TP 1 orientiert sich dabei am SAMi-Projekt als Musterbeispiel und betrachtet drei Forschungsfragen, die als überprüfbare Hypothesen formuliert sind:
(1) Die Verwendung von Value Sensitive Design (VSD)-Methoden führt zu einer höheren Akzeptanzrate der Technologieentwicklungsforschung und zu einer geringeren Anzahl von Fällen potenzieller Wertkonflikte zwischen Interessengruppen.
(2) Die Verwendung von Ersatztechnologien zur Ermittlung der Grundwahrheit gleicht den durch diese Technologien verursachten Informationsverlust aus.
(3) Wenn Stakeholder, die an der Ontologiekonstruktion teilnehmen, Hintergrundinformationen zu den Prinzipien und Grenzen der Computerverhaltensanalys erhalten, wird (3a) die Akzeptanz der Technologie erhöht und (3b) das erwartete semantische Differential im Systembetrieb reduziert, wie es durch die Affektkontrolle-Theorie messbar ist.
Die Forschungsmethodik folgt dabei dem VSD-Framework.
TP2: Co-intelligente Assistenzsysteme in der ambulanten Demenzpflege
Teilprojekt 2 (TP 2) wird an der Abteilung Assistenzsysteme und Medizintechnik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg von Prof. Dr.-Ing. Andreas Hein geleitet.
Ziel
Ziel dieses Teilprojektes ist es, zu untersuchen, inwiefern verschiedene Assistenzsysteme, die mit Fokus auf Patient*innen ohne kognitive Einschränkungen entwickelt wurden, auch bei der Behandlung von Personen mit Demenz eingesetzt werden können. Zudem soll untersucht werden, ob und wenn ja welche Barrieren bei einem solchen Einsatz existieren. Die konkreten Anwendungsfälle umfassen dabei sensorbasierte Monitoringsysteme und robotische Assistenzsysteme. Diese wurden von der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Hein für den Einsatz in der Häuslichkeit älterer Menschen und zur Unterstützung der häuslichen Pflege (Palliativpflege, Intensivpflege, etc.) schon entwickelt. Beide Systeme haben das Potenzial, Personen mit Demenz und deren Betreuende/Pflegende zu stärken, können aber auch die privaten Pflegebeziehungen und das berufliche Selbstverständnis beeinträchtigen.
Methodik
Das TP 2 wird insbesondere die folgenden Teilfragen untersuchen:
(1) Welche technischen Ansätze können für die Lokalisierung von Personen mit Demenz im Innen- und Außenbereich verwendet werden? Wie kann ein Kompromiss zwischen einer ausreichenden technischen Genauigkeit für den Betreuenden einerseits und dem Schutz der Privatsphäre der Person mit Demenz andererseits gefunden werden?
(2) Wie können aus den technischen Beobachtungen Funktionsparameter der Person mit Demenz abgeleitet und typische Verhaltensmuster erlernt werden? Wie werden normales Verhalten und Abweichungen von diesem interpretiert?
(3) Wie können Robotersysteme in die Pflege von Personen mit Demenz integriert werden? Welche Interaktionsformen sind angemessen? Welche Zielparameter können von Roboterassistenzsystemen automatisch gesteuert werden? Wie können Robotersysteme Personen mit Demenz und Betreuende/ Pflegende unterstützen?
Zur Beantwortung dieser Fragen wird ein szenariobasierter Ansatz verwendet. In Hinblick auf Frage 1 wurden im QuoVadis-Projekt (Leitung Prof. Dr. Hein), bereits Versorgungsszenarien von Personen mit Demenz mit Relevanz für das Alltagsleben erhoben. Diese werden durch eine Analyse von qualitativen Interviews mit Experten (n≥5) und Angehörigen (n≥5) in Hinblick auf Frage 2 und 3 ergänzt. Die Interviews werden in enger Zusammenarbeit mit TP3 und TP4 durchgeführt. Pro Forschungsfrage wird dann mindestens ein Szenario in den Forschungslaboren der Universität Oldenburg (RoboticCareLab) und bei OFFIS (IdeAAL Lab) implementiert.
Folgende drei Szenarien von bereits bestehenden Assistenzsystemen sollen auf die Anwendung bei Personen mit Demenz übertragen werden:
(1) Sicherheitsszenarien aus dem Projekt QuoVadis (sensorbasiertes Monitoringsystem),
(2) Unterstützungsszenarien aus dem Projekt GAL (sensorbasiertes Monitoringsystem für komplexe Aktivitätsketten)
(3) Robotische Assistenzsysteme aus den BMBF-Projekten iTAGAP und PIZ (Unterstützung für Pflegende und PatientInnen im ambulanten Bereich).
TP3: Betroffenenperspektiven zu CIMADeC und die Ethik der Privatheit
Teilprojekt 3 (TP 3) wird an der Abteilung Ethik in der Medizin der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg von Prof. Dr. Mark Schweda geleitet.
Ziel
Ziel dieses Teilprojekts ist es, die Perspektiven der Betroffenen mit Blick auf die CIMADeC Fallstudien aus TP 1 und TP 2 zu erheben und zu untersuchen. Dabei liegt der Fokus auf der Analyse der Akzeptanz und Akzeptabilität der Technologien unter besonderer Berücksichtigung von Verständnissen von und Anforderungen an Privatheit in der Pflege.
CIMADeC fordert hergebrachte Vorstellungen von Privatheit heraus. Co-intelligente Sensortechnologie und robotische Assistenzsysteme können zum Schutz und der Stärkung von Privatheit in der Pflege beitragen. Sie können jedoch auch mit der wesentlich privaten Dimension des Selbstverständnisses und der Selbstdeutung sowie des Alltagslebens der betroffenen und beteiligten Personen in Konflikt geraten. Weitere Herausforderungen können in Bezug auf die Sorgebeziehungen in häuslichen und institutionellen Kontexten auftreten. Diese potenziellen Konflikte können erhebliche Auswirkungen auf die Akzeptanz der Technologien in haben und machen die Entwicklung eines tieferen und umfassenderen Verständnisses des Wertes von Privatheit für ein gutes Leben in intakten Sorgebeziehungen erforderlich. Deshalb befasst sich TP 3 auch mit den Verständnissen der Teilnehmenden von individuellem Wohlergehen und persönlichen Nahbeziehungen im Kontext ihrer Bewertung der technischen Interventionen.
Methodik
Um die Sichtweisen der Betroffenen auf CIMADeC in die ethische Auseinandersetzung einzubeziehen, wird diese durch Methoden qualitativer Sozialforschung ergänzt und angereichert. Zunächst wird eine systematische Analyse des wissenschaftlichen Diskurses über Privatheit im Kontext der Pflege von Menschen mit Demenz durchgeführt. Davon ausgehend werden mittels halbstrukturierter qualitativer Interviews (n≈30) die entsprechenden Vorstellungen und Bedürfnisse der betroffenen Personen und die zugrundeliegenden Auffassungen und Einstellungen untersucht. Dabei werden sowohl Menschen mit Demenz selbst als auch sorgende Angehörige im häuslichen und stationären Setting befragt. Auf dieser Grundlage soll der Wert von Privatheit im Kontext der technisch assistierten Versorgung von Menschen mit Demenz empirisch exploriert und ethisch konzeptualisiert werden. Dabei werden auch angrenzende Themen wie z. B. Vertrautheit, Häuslichkeit oder Geborgenheit in die Betrachtung einbezogen.
TP4: Professionsperspektiven zu CIMADeC und Empowerment-Ethik
Teilprojekt 4 (TP 4) wird am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin der Universitätsmedizin Göttingen von Prof. Dr. Silke Schicktanz geleitet.
Ziel
Ziel dieses Teilprojekts ist es, die Perspektiven der Betroffenen mit Blick auf die CIMADeC Fallstudien aus TP 1 und TP 2 zu erheben und zu untersuchen. Dabei liegt der Fokus auf der Analyse der Akzeptanz und Akzeptabilität der Technologien unter besonderer Berücksichtigung von Verständnissen von und Anforderungen an Privatheit in der Pflege.
CIMADeC fordert hergebrachte Vorstellungen von Privatheit heraus. Co-intelligente Sensortechnologie und robotische Assistenzsysteme können zum Schutz und der Stärkung von Privatheit in der Pflege beitragen. Sie können jedoch auch mit der wesentlich privaten Dimension des Selbstverständnisses und der Selbstdeutung sowie des Alltagslebens der betroffenen und beteiligten Personen in Konflikt geraten. Weitere Herausforderungen können in Bezug auf die Sorgebeziehungen in häuslichen und institutionellen Kontexten auftreten. Diese potenziellen Konflikte können erhebliche Auswirkungen auf die Akzeptanz der Technologien in haben und machen die Entwicklung eines tieferen und umfassenderen Verständnisses des Wertes von Privatheit für ein gutes Leben in intakten Sorgebeziehungen erforderlich. Deshalb befasst sich TP 3 auch mit den Verständnissen der Teilnehmenden von individuellem Wohlergehen und persönlichen Nahbeziehungen im Kontext ihrer Bewertung der technischen Interventionen.
Methodik
Um die Sichtweisen der Betroffenen auf CIMADeC in die ethische Auseinandersetzung einzubeziehen, wird diese durch Methoden qualitativer Sozialforschung ergänzt und angereichert. Zunächst wird eine systematische Analyse des wissenschaftlichen Diskurses über Privatheit im Kontext der Pflege von Menschen mit Demenz durchgeführt. Davon ausgehend werden mittels halbstrukturierter qualitativer Interviews (n≈30) die entsprechenden Vorstellungen und Bedürfnisse der betroffenen Personen und die zugrundeliegenden Auffassungen und Einstellungen untersucht. Dabei werden sowohl Menschen mit Demenz selbst als auch sorgende Angehörige im häuslichen und stationären Setting befragt. Auf dieser Grundlage soll der Wert von Privatheit im Kontext der technisch assistierten Versorgung von Menschen mit Demenz empirisch exploriert und ethisch konzeptualisiert werden. Dabei werden auch angrenzende Themen wie z. B. Vertrautheit, Häuslichkeit oder Geborgenheit in die Betrachtung einbezogen.
Projektmitarbeitende
TP1: Wertsensitives und affektbewusstes Design
Leitung:
- Prof. Dr. Thomas Kirste
- Prof. Dr. Stefan Teipel
Mitarbeitende:
- M. Salman Shaukat, M.Sc.
- Moh’d Abuazizeh, Dipl.‐Ing. FH (MMIS)
- Stefanie Köhler (DZNE)
TP2: Co-intelligente Assistenzsysteme in der ambulanten Demenzpflege
Leitung:
- Prof. Dr. Andreas Hein
Mitarbeitende:
- Julia Wojzischke, M.Sc. (01/2020-03/2020)
- Kerstin Hackelbusch, M.Sc. (07/2020-04/2021)
- Marie Sgraja (11/2021‐12/2022)
Assoziierte Mitarbeitende:
- Dr. Rebecca Diekmann
- Carolin Lübbe, M.Sc.
TP3: Betroffenenperspektiven zu CIMADeC und die Ethik der Privatheit
Leitung:
- Prof. Dr. Mark Schweda
Mitarbeitende:
- Eike Buhr, M.Ed.
TP4: Professionsperspektiven zu CIMADeC und Empowerment-Ethik
Leitung:
- Prof. Dr. Silke Schicktanz
Projektmitarbeitende:
- Julia Perry, M.A. (01/2020 - 12/2022)
- Johannes Welsch, M.A. (01/2020 - 12/2022)
- Niklas Petersen, M.A. (02/2023 - 05/2023)
- Sabrina Krohm, M.A. (02/2020 - 03/2021 wissenschaftliche Hilfskraft; 11/2022 - 06/2023 wissenschaftliche Mitarbeiterin)
- Jana Wegehöft, B.A. (11/2022-06/2023)
- Julia Brose, B.A.
- Julia Wüstefeld, B.A.
Assoziierte Mitarbeitende:
- Dr. Hanan Abo Jabel (11/2020-12/2022)
Medizinische Doktorandin:
- Clara Löbe, cand. med. (seit 10/2020)
Projektergebnisse
Internationales Symposium "The Future of Assistive Technologies in Dementia Care – An Interdisciplinary Dialogue"

Das internationale Symposium, organisiert im Rahmen des EIDEC Projekts durch das Projektteam um die leitenden Wissenschaftler:innen (PIs) Silke Schicktanz, Mark Schweda, Andreas Hein, Stefan Teipel, Thomas Kirste und Projektkoordination Julia Perry in Kooperation mit dem Hanse-Wissenschaftskolleg fand vom 6. bis 8. September 2022 im Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) in Delmenhorst statt. Die Fachtagung fokussierte die Zukunft von intelligenten Assistenzsystemen in der Demenzpflege und lud hierfür hochkarätige internationale Wissenschaftler*innen ein, um innovative, herausfordernde Forschungsfragen zu assistiven Technologien in der Demenzversorgung zu beleuchten, die es in Zukunft zu bearbeiten gilt. Dafür wurde sich an drei Tagen zu aktuellen Forschungsprojekten in einem interdisziplinären Kontext ausgetauscht, diskutiert und darüber nachgedacht, wie Projektergebnisse auch an Akteur*innen außerhalb der Wissenschaft transferiert werden können. Zusätzlich gab die Tagung den Forschenden Einblicke in die Ergebnisse unseres Forschungsprojekts EIDEC.
Wir zeichneten die Beiträge und Diskussionen dabei audio-visuell auf, um diese in Form von drei Videos für Sie zur Verfügung zu stellen. Wir danken insbesondere Alicia Teschner für das Erstellen der Videos.
Programm
Tag 1: Dienstag, der 06. September 2022
- Willkommen und Einführung.
Prof. Silke Schicktanz und Prof. Mark Schweda - Präsentation: A Novel Cognitive Assessment Scenario in Dementia Using Social Assistive Robots.
Associate Prof. Filippo Cavallo, University of Florence, Florence, Italien - Standpunkte: Value-Sensitive Design in Practice: Insights and Challenges.
Prof. Thomas Kirste, Prof. Andreas Hein und Prof. Stefan Teipel - Präsentation via Zoom: Anatomy is Not Destiny: Creating Eyeglasses for the Mind.
Prof. Gerhard Fischer, University of Colorado, Boulder, USA
Hier die Folien zum Download als PDF - Keynote Lecture via Zoom: Tackling Loneliness in Diverse Communities: Value Sensitive Design of Social Robotics for LGBTIQ Elderly.
Prof. Oliver Burmeister, Charles Sturt University, Orange, Australien
Hier die Folien zum Download als PDF
Tag 2: Mittwoch, der 07. September 2022
- Präsentation via Zoom: Artificial Systems with Moral Capacities? Theoretical Foundations and a Roadmap for a Geriatric Care System.
Prof. Catrin Misselhorn, University of Göttingen, Göttingen, Germany - Präsentation: The Value and Role of Smart Technologies in Caring for Older Persons with Dementia.
Dr. Tenzin Wangmo, Universität Basel, Basel, Schweiz - Standpunkte: Ethical Challenges of Assistive Technologies: An Empirical Assessment of Affected Persons’ Attitudes.
Prof. Silke Schicktanz und Prof. Mark Schweda - Präsentation via Zoom: Confronting Power in Our Conversations about Ethics in Dementia Care Technologies.
Associate Prof. Clara Berridge, University of Washington, Seattle, USA
Tag 3: Donnerstag, der 08. September 2022
- Präsentation: „The Technological Way of Being” and Human Flourishing in Health Care: Antithesis or Synthesis?
Prof. Fabrice Jotterand, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, USA - Keynote Lecture via Zoom: In Dementia Care, Have We ‘Grown Mechanical in Head and in Heart’? And If So, So What?
Prof. Julian C. Hughes, Bristol Medical School (PHS), Bristol, Großbritannien - Finale Diskussion und Ausblick
Wissenschaftliche Poster
- Eike Buhr & Mark Schweda: The value of privacy in the context of technical assistance for people with dementia: an empirically informed ethical analysis.
Hier das Poster zum Download als PDF - Yi Jiao (Angelina) Tian, Nadine Andrea Felber, Felix Pageau, Delphine Roulet Schwab & Tenzin Wangmo: A systematic review of the opportunities and barriers of smart home health technologies in the care of older persons.
Hier das Poster zum Download als PDF - Johannes Welsch: Empowerment and technology. An ethical-empirical exploration of technology-assisted dementia care.
Hier das Poster zum Download als PDF - M. Salman Shaukat, Johann-Christian Põder, Sebastian Bader & Thomas Kirste: Towards measuring “ethicality” of an intelligent assistive system.
Hier das Poster zum Download als PDF - Frederik Pohlmann, Rebecca Diekmann, Andrea Klausen, ML Reuss, Mark Schweda & Andreas Hein: Do scenario-based online interviews promote a change in attitudes towards assistance systems among relatives of patients with dementia?
Hier das Poster zum Download als PDF - Hanan AboJabel, Johannes Welsch & Silke Schicktanz: Cross-cultural perspectives on intelligent assistive technology in dementia care: Comparing Israeli and German experts’ attitudes.
Hier das Poster zum Download als PDF
Dreiteilige Videoreihe "Digitale Assitenztechnologien"
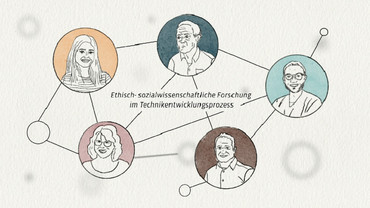
Die Einführung neuer Technologien, wie zum Beispiel digitale Assistenztechnologien für Menschen mit Demenz, ist mit verschiedenen ethischen und sozialen Herausforderungen verbunden. Diese dreiteilige Videoreihe zeigt, welchen Mehrwehrt ethisch-sozialwissenschaftliche Forschung im Technikentwicklungsprozess hat und wie verschiedene Akteur*innen in den Prozess mit einbezogen werden können.
Die Videoreihe entstand im Frühjahr 2023 und wurde dabei vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Wir bedanken uns insbesondere bei Prof. Dr.-Ing. Gesine Marquardt & Dr.-Ing. Kathrin Büter von der Fakultät für Architektur der Technischen Universität Dresden für die Planung und Koordination der grafischen und technischen Umsetzung.
- Das Video 1 fokussiert die Perspektive der Technikentwickler*innen. In dem Video wird verdeutlicht, welche Potentiale ethisch-sozialwissenschaftliche Forschung im Technikentwicklungsprozess hat und wie wichtig die Erstellung von idealtypischen Nutzerprofilen ist. Die ermöglichen Zielkonflikte und Werte darzustellen und im weiteren Schritt in den Technikentwicklungsprozess eingebunden werden können.
- Das Video 2 fokussiert die Perspektive der beruflich Pflegenden. In dem Video wird die Rolle der Pflegenden bei der Erkennung von Schwierigkeiten in der technischen Umsetzung von digitalen Assistenzsystemen in der Praxis thematisiert. Sichtbar wird auch, wie sich Pflegende in den Prozess der Technikentwicklung sowie Weiterentwicklung einbringen können.
- Das Video fokussiert die Perspektive der Demenz-Betroffenen. Thematisiert wird in dem Video, wie individuelle Bedürfnisse bei der Nutzung von digitalen Assistenztechnologien betrachtet werden müssen. Aber auch, wie wichtig die Erfahrungen von Demenz-Betroffenen mit den Technologien für die Weiterentwicklung der Assistenzsysteme sind.
Weitere Informationen zur Entwicklung und Umsetzung der Videoreihe
Planung und Koordination des Gesamtprojektes:
- Prof. Dr. Silke Schicktanz (Medizinethik, Universitätsmedizin Göttingen)
Leitende Wissenschaftler der Teilprojekte:
- Prof. Dr. Andreas Hein (Gesundheits-Ingenieurwissenschaften, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
- Prof. Dr. Thomas Kirste (Informatik, Universität Rostock)
- Prof. Dr. Mark Schweda (Medizinethik, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
- Prof. Dr. Stefan Teipel (Universitätsmedizin Rostock/ Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V. (DZNE))
Inputs für Ideen und Skripte der vorliegenden Videos kamen insbesondere von folgenden beteiligten Wissenschaftler*innen:
- Eike Buhr, M.Ed. (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
- Dr. Rebecca Diekmann (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
- Sabrina Krohm, M.A. (Universitätsmedizin Göttingen)
- Julia Perry, M.A. (Universitätsmedizin Göttingen)
- Salman Shaukat, M.Sc. (Universität Rostock)
- Johannes Welsch, M.A. (Universitätsmedizin Göttingen)
Planung und Koordination der grafischen und technischen Umsetzung:
- Prof. Dr.-Ing. Gesine Marquardt (Fakultät Architektur, Technische Universität Dresden)
- Dr.-Ing. Kathrin Büter (Fakultät Architektur, Technische Universität Dresden)
Grafik, Animation und Schnitt:
- Charlott Kurek (Kommunikationsdesignerin Dresden)
Sprecherin und Tonaufnahme:
- Anne Grabowski (Folge 1 und 3)
- Mike Langhans (Folge 2)
Podcast Demenz-Assistenz
Die vierteilige Podcastreihe Demenz-Assistenz ist ein Podcast über Künstliche Intelligenz und Robotik in der Pflege von Menschen mit Demenz.
Im Podcast Demenz-Assistenz haben wir Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis eingeladen, um mit Ihnen über aktuelle ethische, soziale und praktische Fragen in der Entwicklung von unterstützenden Technologien zu diskutieren.
Die Podcastreihe entstand im Sommer 2023 und wurde dabei vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
Einzelne Informationen zu den jeweiligen Folgen entnehmen Sie den Beschreibungen sowie weiterführenden Informationen der Episoden.
In der Einstiegsfolge "EIDEC – Ein Forschungsprojekt stellt sich" vor sprechen wir mit den Projektleitenden des EIDEC Projekts über die Ausrichtung der Forschung, die einzelnen Teilprojekte, Ergebnisse und die Erfahrungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Wir klären auf, was hinter dem doch erst einmal sperrig klingenden Titel des Projekts, aber auch dem Begriff der Assistenzsysteme steckt und lernen die Forschungsleitenden sowie ihre verschiedenen wissenschaftlichen Arbeitsgebiete kennen.
In der Folge "Demenz, Digitalisierung und Technik – Entwicklungen sowie Chancen neuer Pflegetechnologien in Politik, Wissenschaft, Pflege und Gesellschaft" haben wir Dr. Mone Spindler vom Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) in Tübingen zu Gast. Mit ihr sprechen wir über derzeitige Entwicklungen von (Demenz-)Pflegetechnologien und erörtern im Gespräch, welche Möglichkeiten, Herausforderungen und Alternativen sich für diese Systeme ergeben.
Mit Niklas Ellerich-Groppe vom Departement für Versorgungsforschung der Universität Oldenburg und dem Forschungs- und Entwicklungsbereich Gesundheit am OFFIS - Institut für Informatik sprechen wir in der Folge "Robotik und Diversität – Auf dem Weg zu diversitätssensibler Robotik?" über den Zusammenhang von Diversität und Robotik. Aber auch welche Hürden und Möglichkeiten es auf dem Weg hin zu einer diversitätssensiblen Robotik gibt.
In der Folge "Technologien und Pflegepraxis – Erfahrungen im Einsatz von Assistenzsystemen in der Pflege von Menschen mit Demenz" sprechen wir mit der Leiterin des Pflegepraxiszentrums Nürnberg Marlene Klemm über ihre Erfahrungen im Einsatz bzw. der Testung von Assistenz-systemen in der Pflege von Menschen mit Demenz. Sie erhalten einen Einblick in die Arbeit des PPZs und die Herausforderung die mit der Implementierung neuer Technologien in der Pflegepraxis einhergehen.
Weitere Informationen zur Entwicklung und Umsetzung der Podcastreihe
Moderation:
Jana Wegehöft
Schnitt:
Vincent Alex
Intro/ OutroGestaltung:
Peter Strauch/ Jingle4U
Produktion:
Arbeitsgruppe Kultur und Ethik an der Universitätsmedizin Göttingen unter
Jana Wegehöft
Sabrina Krohm
Produktionszusammenarbeit:
Abteilung Assistenzsysteme und Medizintechnik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Abteilung Ethik in der Medizin der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen
Institut für Visual and Analytic Computing der Universität Rostock
Publikationen
- Köhler, S., Perry, J., Biernetzky, O.A., Kirste, T. & Teipel, S.J. (2024): Ethics, design, and implementation criteria of digital assistive technologies for people with dementia from a multiple stakeholder perspective: a qualitative study. BMC Med Ethics 25(84). DOI: 10.1186/s12910-024-01080-6
- Buhr, E., Welsch, J. & Shaukat, M.S. (2024) Value preference profiles and ethical compliance quantification: a new approach for ethics by design in technology-assisted dementia care. AI & Soc. DOI: 10.1007/s00146-024-01947-7
- AboJabel, H., Welsch, J. & Schicktanz, S. (2024): Cross-cultural perspectives on intelligent assistive technology in dementia care: comparing Israeli and German experts’ attitudes. BMC Med Ethics, 25(15). DOI: 10.1186/s12910-024-01010-6
- Raz, A., Minari, J.,Schicktanz, S., Sharon, T., Werner-Felmayer, G. (2023) Eds.: Data-intensive medicine and healthcare: ethical and social implications in the era of artificial intelligence and automated decision-making. Frontiers Genetics, 14(1280344). DOI: 10.3389/fgene.2023.1280344
- Schicktanz, S., Welsch, J., Schweda, M., Hein, A., Rieger, J.W., Kirste, T. (2023): AI-Assisted Ethics? Considerations of AI Simulation for the Ethical Assessment and Design of Assistive Technologies. Frontiers in Genetics,14(1039839). DOI: 10.3389/fgene.2023.1039839
- Köhler, S., Görß, D., Kowe, A., Teipel, S. (2022): Matching values to technology: a value sensitive design approach to identify values and use cases of an assistive system for people with dementia in institutional care. Ethics and Information Technology, 24(3), 27. DOI: 10.1007/s10676-022-09656-9
- Buhr, E., Schweda, M. (2022): Technische Assistenzsysteme für Menschen mit Demenz: Zur ethischen Bedeutung von Beziehungen. In: Friedrich, Orsolya et al. (Hg.): Mensch-Maschine-Interaktion – Konzeptionelle, soziale und ethische Implikationen neuer Mensch-Technik-Verhältnisse. Paderborn: mentis, 284-301. DOI: 10.30965/9783969752609_022
- Buhr, E., Schweda, M. (2022): Der Wert des Privaten für Menschen mit Demenz. Ethik Med, 266(5), S. 7. DOI: 10.1007/s00481-022-00723-9
- Buhr, E., Welsch, J.(2022): Privacy-sensitive Empowerment. Towards an Integrated Concept for Technology Assisted Care for People with Dementia. In: Rubeis, G. et al. (Hg.): Digitalisierung der Pflege. Interdisziplinäre Perspektiven auf digitale Transformation in der pflegerischen Praxis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 185-197, ISBN E-Lib: 9783737014793. DOI: 10.14220/9783737014793.185
- Arbeitspapier der Stakeholder-Konferenz zu Digitalen Assistenzsystemen für Menschen mit Demenz, pflegende Angehörige und Pflegekräfte im Rahmen des EIDEC-Projektes am 31.03.2022. Arbeitspapier zum Download
- Welsch, J.(2022): Empowerment and Technology. An ethical-empirical exploration of technology-assisted dementia care [Poster]
- Löbe, C., Abo Jabel, H.(2022): Empowering people with dementia via using intelligent assistive technology: A scoping review. Archives of Gerontology and Geriatrics, 101(104699). DOI: 10.1016/j.archger.2022.104699
- Schicktanz, S., Schweda, M. (2021): Aging 4.0? Rethinking the ethical framing of technology‐assisted eldercare. History and Philosophy of the Life Sciences, 43(93). DOI: 10.1007/s40656-021-00447-x
- Schweda, M., Schicktanz, S.(2021): Ethische Aspekte co-intelligenter Assistenztechnologien in der Versorgung von Menschen mit Demenz. Psychiatrische Praxis, 48(01). 37–41. DOI: 10.1055/a-1369-3178
- Shaukat, M. S., Põder, J.-C., Bader, S., & Kirste, T. (2021). Towards Measuring Ethicality of an Intelligent Assistive System. Proc. 1st AITHICS workshop (Artificial Intelligence and Ethics) held at 44th German Conference on Artificial Intelligence (KI-2021). DOI: 10.48550/ARXIV.2303.03929
- Shaukat, M. S., Hiller, B. C., Bader, S., & Kirste, T. (2021). SimDem: A Multi-agent Simulation Environment to Model Persons with Dementia and their Assistance. 4th International Workshop on AI for Aging, Rehabilitation and Independent Assisted Living held at IJCAI 2021. http://arxiv.org/abs/2107.05346
- Krohm, S.(2021): ‚Female‘ Care and ‚Male‘ Technology? Pflege und technische Assistenzsysteme aus Sicht beruflich Pflegender - Eine explorative qualitative Interviewstudie. [Poster]
- Schweda, M., Kirste, T., Hein, A., Teipel, S., Schicktanz, S. (2019): The emergence of co-intelligent monitoring and assistive technologies in dementia care - an outline of technological trends and ethical aspects. Bioethica Forum,12 (1/2). 29–37. DOI: 10.24894/BF.2019.12008
Kontakt

Kontaktinformationen
- Telefon: +49 551 3969009
- E-Mail-Adresse: sschick(at)gwdg.de